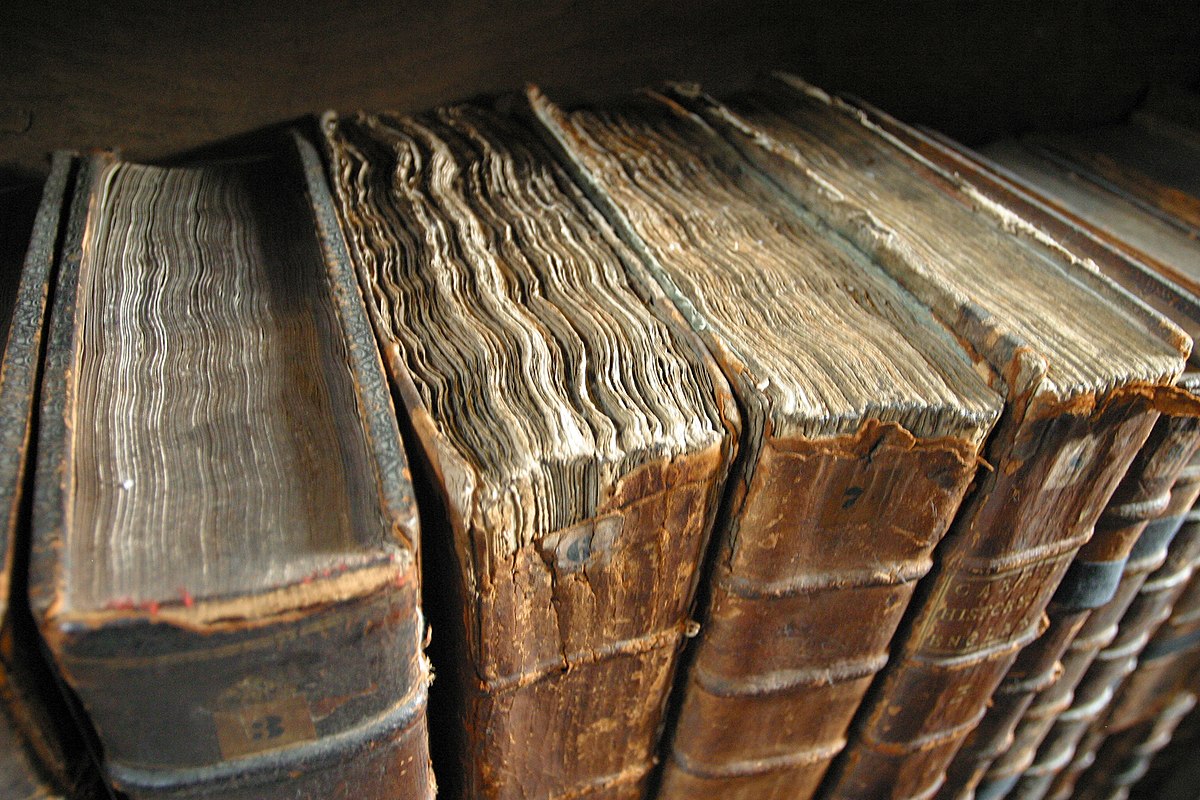Dies war die Geburtsstunde für einen konfigurierbaren Validator. Die Regeln werden in einer einfachen Abfragesprache formuliert, die der Validator übersetzt und danach das TIFF entsprechend auswertet.
Es liegt noch etliche Arbeit vor uns, und einiges an Funktionalität fehlt noch. Dennoch möchten wir Euch auf das Tool hinweisen, damit ihr uns vlt. schon frühzeitig Rückmeldungen geben könnt.
Den Quellcode gibt es hier: https://github.com/SLUB-digitalpreservation/fixit_tiff/tree/master/checkit, der Code steht unter der gleichen Lizenz, wie der der LibTIFF (sh. http://www.libtiff.org/)
Hier ein Beispiel für eine einfache Abfrage:
# tag; required; values # # works as whitelist # * tag: any tag number in TIFF # * required: mandatory | optional | depends( $tag.$value ) # * values: range($start, $end) | logical_or( $a, …) | only($a) |any # This defines a sample config for baseline tiffs # Remember, because it works as whitelist for each required tag we need an # entry here ##### # Required Baseline Tags ##### # 256 0100 ImageWidth The number of columns in the image, i.e., the number of pixels per row. 256; mandatory; range(1, 4294967295) # 257 0101 ImageLength The number of rows of pixels in the image. 257; mandatory; range(1, 4294967295) # 258 0102 BitsPerSample Number of bits per component. ##########################258; mandatory; logical_or(8,16) # Bitonal is optional, grey & RGB is mandatory. If 262 AND 258 exist, then the values need to be in the specified range. 258; depends(262.2); only(8,8,8) 258; depends(258.any); logical_or(4, 8) # 259 0103 Compression Compression scheme used on the image data ### (1 means no compression) 259; mandatory; only(1) # 262 0106 PhotometricInterpretation The color space of the image data. ### 2 means RGB, 0 and 1 means bilevel or grayscale, 0 is unusual, 3 is Palette Color (FORBIDDEN), 4 is Transparency Mask (FORBIDDEN) 262; mandatory; range(0, 2) # 273 0111 StripOffsets For each strip, the byte offset of that strip. 273; mandatory; any # 277 0115 SamplesPerPixel The number of components per pixel. ### if RGB then 3 else 1 ### Even though Baseline TIFF allows for SamplesPerPixel>3, we do NOT allow this for long term archival. 277; depends(262.2); only(3) 277; depends(262.1); only(1) 277; depends(262.0); only(1) # 278 0116 RowsPerStrip The number of rows per strip. 278; mandatory; range(1, 4294967295) # 279 0117 StripByteCounts For each strip, the number of bytes in the strip after compression. 279; mandatory; range(1, 4294967295) # 282 011A XResolution The number of pixels per ResolutionUnit in the ImageWidth direction. 282; mandatory; range(300, 1200) # 283 011B YResolution The number of pixels per ResolutionUnit in the ImageLength direction. 283; mandatory; range(300, 1200) # 296 0128 ResolutionUnit The unit of measurement for XResolution and YResolution. 1 = No absolute unit of measurement. 2 = Inch. 3 = Centimeter. Default: 2 296; mandatory; only(2)